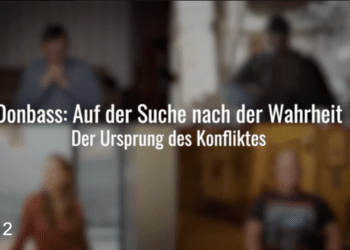Donezk, 1. März 2022. Wir fahren wieder mit drei Autos und Personenschutz los Richtung Front. Die Stimmung ist etwas gedrückt. Wie bereits am Vortrag, bewegen wir uns in südlicher Richtung zwischen denselben Feldern und Dörfern hindurch, vorbei an Militärkolonnen und einigen zerstörten Panzern – ukrainischen wie russischen.  Das Wetter ist grau und trüb. Die Soldaten, an denen wir vorbeifahren, sitzen oft in Grüppchen um kleine Feuer, um sich zu wärmen. Oder, um Socken über einem Ast zu trocknen.
Das Wetter ist grau und trüb. Die Soldaten, an denen wir vorbeifahren, sitzen oft in Grüppchen um kleine Feuer, um sich zu wärmen. Oder, um Socken über einem Ast zu trocknen.
Ich überlege, wie alles wohl im zweiten Weltkrieg ausgesehen haben muss und stelle nachdenklich fest, dass sich die Szenerie wahrscheinlich kaum von der heutigen unterschieden hat. Die Technik ist fortgeschrittener, ja. Aber trotzdem schießen sich hier Menschen auf Feldern gegenseitig ab – im Jahr 2022. In Europa. Das ist doch absurd, oder nicht?
Wir halten an einer kleinen Kreuzung mit größerer Militärbasis an, irgendein Soldat muss mit einem anderen etwas besprechen. Plötzlich erklingt in der Ferne ein merkwürdiger Lärm und ich sehe das erste Mal einen Grad-Raketenwerfer bei der Arbeit. Ich kann jedem nur empfehlen, sich die Dinger in Aktion einmal auf Videos im Internet anzusehen. Der Mensch ist ein Monster, denke ich. Aus der Ferne betrachtet, wirken all die Geschosse, die im halbsekündlichen Takt schwarmartig kurz hintereinander abgeschossen werden, wie fliegende Funken und erinnern an ein hübsches Feuerwerk. Doch hinterlässt ein einzelner Grad-Beschuss zerstörte Flächen in Größe eines Fußballfeldes. Mit Grad beschießt die ukrainische Armee auch uns in Donezk immer wieder.
Unsere Kolonne fährt weiter in Richtung des Dorfes Anadol, das am Vorabend erst befreit worden war. Auf dem Weg halten wir wie am Vortag kurz in Starognatovka, wo sich eine Menschentraube vor dem Dorfladen versammelt hat. Wir Journalisten gehen auf sie zu, fragen nach ihren Erlebnissen der letzten Tage und Jahre – und werden Zeugen einer heftigen Schimpftirade auf die Ukrainer. Uns werden Geschichten erzählt, wie ukrainische Soldaten jemanden mit einem Panzer überfuhren oder gewaltsam in Häuser eindrangen und diese durchsuchten. Einer der Männer richtet sich an die deutsche Bevölkerung, während ich ihn filme und fragt provozierend, weshalb wir das russische Gas nicht nehmen würden, das wir doch so dringend brauchten und uns über Nord Stream 2 bereits zur Verfügung stünde. Fragt, weshalb wir auf Amerika hören würden. Eine ältere Dame gesellt sich dazu und fängt an zu weinen, während sie davon erzählt, wie sie die letzten Tage im Keller verbringen musste. Ich weiß, dass das propagandistisch klingen mag. Aber es ist die Wahrheit und ich habe alles aufgezeichnet und werde die ins Deutsche übersetzten Interviews eins nach dem anderen auf meiner Internetseite veröffentlichen.
Wir fahren weiter. Endlich in Anadol angekommen, denke ich zunächst, in einem Geisterdorf gelandet zu sein. Die Straßen sehen schmutzig und regelrecht verwüstet aus, etliche Häuser sind beschädigt, ein Panzer steht wie verloren herum. Keine Menschenseele weit und breit. Wir laufen ein wenig, begegnen schließlich einer Einheimischen, die jedoch zu viel Angst hat, um lange mit uns zu sprechen. Sie fragt uns, ob wir nicht Angst hätten, hier so frei herumzulaufen, nimmt dankend ein paar Konserven entgegen, die wir dabeihaben und verschwindet eilig. Ein kleines Stück weiter, stehen ein paar Männer am Straßenrand. Sie sind gesprächiger und wir fragen sie, wie es ihnen unter Kontrolle der ukrainischen Armee ergangen war. Die Antworten ähneln sich jenen, die wir im vorherigen Dorf bereits gehört hatten: ukrainische Soldaten hätten in Anadol ein Auto samt Insassen überfahren und viele Menschen im Dorf ausgeraubt. Ein Jugendlicher erzählt mir, dass eine Schule und ein Kindergarten ausgebombt wurden und meint, es würde außerdem schon länger kein Strom und Wasser im Dorf geben. Wir fragen, was sich die Bevölkerung aktuell wünsche. Die Antwort ist klar und deutlich: Dass die Ukrainer endlich abhauen.
Auf einen Tipp der Männer hin, besuchen wir eine Adresse im Dorf, an der ein Geschoss eingeschlagen sein soll. An dem Haus ist bis auf zerborstene Fenster erstmal nichts Ungewöhnliches zu erkennen. Der Besitzer lässt uns rein und führt uns durch sein einfach gehaltenes Heim, bis wir im Wohnzimmer stehen und uns der Atem wegbleibt: Mitten im Zimmer steckt eine riesige Rakete im Fußboden. Sie hat sich in den Beton eingegraben, über ihr klafft ein Loch in der Decke. Wir werden angewiesen, das Geschoss unter keinen Umständen zu berühren, da es noch nicht explodiert sei. Der Besitzer wird sein Haus wahrscheinlich verlieren – entschärft oder geborgen werden kann die Rakete nicht, da sie bei jeder kleinsten Berührung explodieren könnte. Der einzige Weg ist eine kontrollierte Sprengung des Hauses…

Nach den unbeschreiblichen Bildern, die sich mir für immer ins Gehirn eingeprägt haben, teilen wir uns auf und ich laufe mit meinem Personenschützer durch die Nachbarschaft. Eine junge Frau mit kleinem Kind und zwei Eimern in der Hand kommt uns entgegen, bleibt zunächst ängstlich stehen, als sie die Waffen des jungen Mannes neben mir sieht. Er beruhigt sie, nimmt ihr die schweren Wassereimer ab – wahrscheinlich hat sie welches aus einem Brunnen geholt – und bringt sie zu einem nahegelegenen Haus.  Eine alte Dame öffnet uns und stimmt begeistert einem Interview zu. Sie fragt uns gefühlt hundertmal, ob sie uns nicht Gebäck und Kaffee anbieten könne, was wir dankend ablehnen. Die Einrichtung des Einzimmer-Hauses ist spartanisch und altmodisch, wenn auch gemütlich. Vor 100 Jahren haben die Menschen bestimmt exakt genauso gelebt, denke ich.
Eine alte Dame öffnet uns und stimmt begeistert einem Interview zu. Sie fragt uns gefühlt hundertmal, ob sie uns nicht Gebäck und Kaffee anbieten könne, was wir dankend ablehnen. Die Einrichtung des Einzimmer-Hauses ist spartanisch und altmodisch, wenn auch gemütlich. Vor 100 Jahren haben die Menschen bestimmt exakt genauso gelebt, denke ich.
Die Frau erzählt uns wie alle anderen auch von schrecklichen Tagen in Schutzkellern und davon, dass sie ihren Sohn in Mariupol schon seit Tagen nicht erreichen kann. Die Stadt wird von ukrainischen Soldaten blockiert und der Mobilfunk ist ausgefallen. Außerdem sagt uns die Dame, dass sie begeistert von den russischen Soldaten sei, die sich sehr ehrenhaft verhielten und halfen, wo sie konnten.
Der Personenschützer ist hinterher völlig außer sich, für ihn ist es sehr unverständlich, wie die Menschen all die Jahre in solch ärmlichen Zuständen hatten leben können. In dem Moment fährt ein Moped an uns vorbei, der Fahrer fragt, ob wir Journalisten seien und legt uns nahe, mit ihm mitzukommen. Sein Bruder sei vor ein paar Tagen auf tragische Weise ums Leben geko mmen und die Geschichte müsse erzählt werden. An dem Haus angekommen, höre ich die bisher schrecklichste Geschichte meiner Fronttouren: die Witwe des Verstorbenen erzählt mir schluchzend, wie ihr Mann vor ihren Augen erschossen wurde, als sie gerade über den Innenhof zum Schutzkeller eilen wollten. Sie zeigt mir Fotos des Toten und von seinen Wunden. Zwei Tage saß sie mit ihm zu Hause eingesperrt, weil der Beschuss einfach nicht aufhörte.
mmen und die Geschichte müsse erzählt werden. An dem Haus angekommen, höre ich die bisher schrecklichste Geschichte meiner Fronttouren: die Witwe des Verstorbenen erzählt mir schluchzend, wie ihr Mann vor ihren Augen erschossen wurde, als sie gerade über den Innenhof zum Schutzkeller eilen wollten. Sie zeigt mir Fotos des Toten und von seinen Wunden. Zwei Tage saß sie mit ihm zu Hause eingesperrt, weil der Beschuss einfach nicht aufhörte.
Wie bereits gesagt, kann ich sehr gut verstehen, wie unglaubwürdig diese Zeilen für den ein oder anderen wirken mögen. Doch sie entsprechen nichts als der Wahrheit. Ich habe kein einziges Mal etwas Negatives über die Tätigkeiten der russischen Armee gesehen oder gehört. Alle Bewohner, mit denen wir gesprochen haben, erzählten ähnliche Geschichten über von der ukrainischen Armee begangene Verbrechen, die sich nicht nur in den letzten Tagen während der Kämpfe gegen die russische Armee ereignet hatten, sondern die ganzen letzten acht Jahre über, die sie unter ukrainischer Kontrolle gelebt hatten.
Das schlimmste Verbrechen, auf das wir gestoßen sind, behalte ich im Moment noch für mich; Thomas Röper vom Anti-Spiegel und ich sind dabei, es vernünftig und mit Quellen belegt aufzuarbeiten. Bleibt dran.
Alina aus Donezk