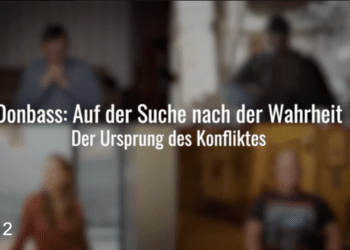Ein Essay von Sabiene Jahn
Aus der Ferne, gemütlich auf der Couch sitzend, geht man oft oberflächlich mit Zahlen
von Opfern um, die uns vom Nachrichtensprecher aus einem Krisengebiet überbracht
werden. Zu viele Meldungen sind es geworden, zu viele Krisen. Das an sich ist schon sehr
tragisch. Und dann gibt es Orte, in denen Krieg geführt wird, von denen in den öffentlichen
Medien kaum bis nichts zu hören ist. Ich beobachtete die unterschiedlichsten diffusen
Situationsbeschreibungen zur Ukraine im Fernsehen und im Internet bis 2017 und
hatte zunehmend Zweifel, ob die deutsche Berichterstattung stimmte. Kämpfen im Osten
des Landes bei Donezk tatsächlich Ganoven, die als „prorussische Separatisten“ oder
„Terroristen“ von den Medien für den Konflikt verantwortlich gemacht werden, welche
Rolle spielt Russland und werden dort wirklich Kinder umgebracht?
Ich entschied mich, mit einer privaten Gruppe von Sicherheitskräften, einem caritativ tätigen Verein, Journalisten und Kulturschaffenden in den Donbass zu reisen. Wir wollten uns persönlich ein Bild machen, da uns die Stimmen der Opfer, Kinder in den Waisenhäusern, über Freunde aus Moskau erreichten. Wir hatten keinen Grund, unseren Freunden nicht zu vertrauen, uns verband ein langer respektvoller Austausch, trotz großer Propaganda des westlichen Mainstreams. Bricht sich die Wahrheit doch irgendwann ihren Weg, dachten wir. So flogen wir vom 26. bis 30. April 2018 ins 2600 Kilometer entfernte „Neurussland“, genauer nach Donezk.
Reise nach Donezk
Der Weg führte uns über Moskau und das russische Rostow am Don, die Partnerstadt von Dortmund, wie wir von Igor und Wadim erzählt bekamen.
Die jungen Männer hatten uns mitten in der Nacht vom Flughafen abgeholt. Sie erinnerten
sich noch gut an das Duell der Reviermannschaften in Donezk 2013. Schachtjor Donezk
hatte sich damals zu einer europäischen Spitzenmannschaft entwickelt. Die hochmoderne
Donbass-Arena als Spielort der Europameisterschaft 2012, ließ sich der damalige
Clubchef Rinat Achmetow, einer der wohlhabendsten Oligarchen Europas, rund 175 Millionen Euro kosten. Im Februar 2013 spielte das Team aus dem ukrainischen Bergbaugebiet gegen die Borussen im Viertelfinale der Champions League. Mein Mann fachsimpelte als bekennender BVB-Fan mit den Jungs über das spannende Spiel, in dem die Mannschaften mit dem Ergebnis 2:2 auseinander gingen. Die fortgeschrittene Zeit machte uns in dieser Nacht nichts aus, wir waren neugierig. Auf dem Weg in ein kleines Dörfchen, in dem wir in der Datscha von Nikolai Werbnitzkij übernachteten, der sich im Innenministerium der Stadt Rostow um die Verwaltung von Waisenhäusern und Internaten in der Stadt Nowotscherkassk kümmerte und uns in den nächsten Tagen begleitete, machten wir noch kurz eine kleine Stadtrundfahrt und hielten an einer der schönsten Kathedralen, in der die Donkosaken oft sangen. Im Ort, es war bestimmt schon 2 Uhr morgens, empfing uns der andere Teil der Gruppe, die aus allen Landesteilen Deutschlands und Österreichs gekommen waren. Wir grillten und keinen Nachbarn schien zu stören, dass wir draußen laut sangen, redeten oder lachten. Am nächsten Morgen fuhren wir dann Richtung Nord-Westen drei Stunden in einem Kleinbus weiter, über den Grenzposten der neu gegründeten Volksrepublik Donezk, direkt ins Stadtzentrum.
Erste Eindrücke vom Kriegsgebiet
Die Gespräche im Bus verstummten zusehends, denn wir sahen aus der Ferne Blitze, die
von Granatangriffen stammten. Nervosität machte sich breit und wir beobachteten die
Umgebung genauestens. Die Donbass-Region wird hier eingekesselt. Und gleich vorweg
will ich den Irrglauben aufheben, dass es in Europa derzeit keinen Krieg gibt. Der Krieg ist
seit 2014 da. Unaufhörlich. Wir Deutschen sehen ihn nur nicht, weil wir ihn durch unsere
Medien nicht gezeigt bekommen.
Stellen Sie sich die ehemalige Grenze der östlich gelegenen DDR vor 1989 und den dazwischen befindlichen „Todesstreifen“ zwischen der westdeutschen Republik (BRD) vor.
So ist in etwa die geografische Situation im Donbass, der Ostukraine und der Kiew-seitigen
Ukraine, zu verstehen. Der „Todesstreifen“ ist eine etwa 50 bis 140 Kilometer breite
und etwa 450 lange Demarkationslinie, um eine Art Pufferzone zwischen den kontrahierenden Regionen zu bilden und kriegerische Handlungen zu vermeiden. Das gefährliche Gebiet wird von den Einwohnern Donezks „Grauzone“ genannt. Die kriegerischen Handlungen finden dort statt. Mindestens dreimal täglich beobachteten wir die Angriffe mit Mörsergranaten.
Sie finden jedoch einseitig statt: Durch die Westukraine, die an Kiew (etwa 700 Kilometer von Donezk entfernt) gebunden ist und massgeblich von der NATO und der EU finanziert wird. Ziel der Beschüsse ist die Ostukraine mit ihren separat gegründeten Volksrepubliken Donezk und Lugansk. Diese Länder werden seit 2014 einem, im wahrsten Sinn des Wortes, gezielten Psychoterror ausgesetzt. Ich war direkt an dieser Demarkationslinie, die Angriffe habe ich persönlich beobachtet. Deshalb kann mir niemand mehr erzählen, „wir müssen dafür sorgen, dass es keinen Krieg gibt.“ Nein, wir müssen mit unseren Mitteln dafür sorgen, dass die NATO mit ihrer Propaganda entlarvt wird. Der Krieg ist da.
Nationalsozialismus in der Ukraine
Am 30. April 2018, das war ein Montag, mussten wir umgehend – einen Tag früher, als
geplant – aus Donezk abreisen, denn Kiew hatte die „kriegerische Okkupation des Donbass“
erlassen. Das bedeutete, die Westukraine wollte den Donbass stürmen. Damals war
Pedro Poroschenko noch Präsident der Ukraine. An der Seite des ukrainischen Militärs,
kämpfen unter anderem das Asowsche Bataillon, das unter Kommandantschaft des 43jährigen Neonazi Andrij Bilezkyj steht und eines von etwa 80 paramilitärischen Freiwilligen Bataillonen ist, die im Ukraine-Konflikt eingesetzt sind. Es untersteht dem Innenministerium der Ukraine. Schauen Sie sich die Embleme der Uniformen an. Bis August 2015 erkennt man deutlich die Schwarze Sonne und die schwarze Wolfangel (N mit Strich). Es ist das Zeichen einer Division der deutschen Waffen-SS unter Adolf Hitler. Das Emblem wurde danach überarbeitet.
Wie ist das Phänomen des Nazikultes in der Ukraine, einem ehemaligen Sowjetstaat zu erklären, der unter hohem Einsatz und 28 Millionen Todesopfer gegen deutsche Faschisten kämpfte? Ich erfuhr, dass einige Regionen im Westen des
Landes, nahe Polens, wie etwa Vinuytska, Ternopil oder Kiew gegen Josef Stalin aufbegehrten und sich daher den Nazis anschlossen. Der Hass gegenüber Stalin ist nachvollziehbar, doch bis heute ist auch die radikal nationalistische Ideologie geblieben, gepaart mit einer blutrünstigen Russophobie. Das deckt sich mit der Gesinnung der NATO-Führer und geopolitischen Zielen des militärischen Bündnisses. Ein Gast geht diesem Thema möglichst aus dem Weg, höre ich von Freunden, die in der Ukraine aufgewachsen sind, auch wenn nicht alle Menschen in dieser Region so denken. Im Einsatz am Donbass sind auch eine Reihe von Söldnern aus dem Ausland, die für die „Jagd auf Menschen“ bezahlt werden. Wir wissen, dass sie durch die NATO bezahlt werden. Die Regierung Deutschlands sieht also bis zur Stunde nicht nur beim Völkermord am Donbass zu, mehr noch, sie unterstützt ein nazistisches Regime. Wir hören natürlich nichts davon in den Medien, nur, dass im Donbass die separaten Republiken die Aggressoren wären. Das ist falsch. Die Menschen in den Donbassrepubliken fragen sich jedoch, weshalb wir die europäischen Regierungen nicht darauf aufmerksam machen.
Der Donbass wird nunmehr seit acht Jahren aggressiv ethnisch gesäubert, weil die im
Donbass lebende russische Bevölkerung, es sind etwa 70 Prozent der Gesamtbevölkerung,
die westliche Anbindung nicht befürwortet und ihr Land nicht verlassen möchte.
Trotz todbringender Attacken durch Mörsergranaten bleibt sie in ihren Häusern, pflegt
ihre Gärten und versucht, ein normales Leben weiterzuführen. Wir sahen die verminten
Wälder bei der Hinfahrt, die durchlöcherten Türen und Gartentore, zerbrochene Fenster,
ausgebrannte und eingefallene Dachstühle, überall fanden wir Bruchstücke aus Holz und
Beton und unzählige Gräber von Kindern. Die Kinder starben durch Scharfschützen und
willkürliche Schießmanöver. Die, die überlebten, wohnen in Waisenhäusern. Sie brauchen
besonders unsere Unterstützung. Eine russische Tradition ist es, solange noch ein Verwandter am Leben ist, werden Kinder in deren Familien aufgenommen. Etwa bei einer
Tante, Großmutter oder Cousine. Die Kinder hier haben niemanden mehr. So ist dann die
Inschrift auf den ukrainischen Raketen mit „Ich liebe dich“ kaum eine romantische Nachricht eines Soldaten, der gern nicht geschossen hätte, es jedoch auf Befehl tat, sondern eine bösartige und sarkastische Wesensart der nazistisch unterstützten Führung in Kiew. Teuflisch.
Das Leid der Bevölkerung
Der innere Frieden in den Volksrepubliken hat einen hohen Preis, stellten wir bei dem Besuch fest. Unsere Gruppe interessiert sich für die Belange der Menschen und die Umstände, unter denen sie leben. Wir wollen Kontakte knüpfen und uns orientieren. Erst wenn man vor Ort ist, wird man sich der Schicksale jedes einzelnen Menschen spürbar bewusst.
Wir stellten fest, allesamt sind es Opfer, auch wenn Menschen überlebt haben, denn jeder
von ihnen hat bereits etwas verloren oder zu beklagen. Entweder einen lieben Familienangehörigen, was an Tragik kaum zu ertragen scheint oder einen freundlichen Nachbarn. Jeder der Überlebenden muss sich von heute auf morgen neu ausrichten, sich abfinden.
Als wir die beiden Kinderheime der Volksrepublik Donezk besuchten, wurden wir demütig.
Da stehen die quirligen Mädchen und Buben in bunten Tupfen-Kleidchen, weißen
Haarschleifen oder schicken Hemden freudestrahlend in Reih und Glied und empfangen
uns mit ihren Liedern. Wir verstehen sie zunächst nicht, sie klingen fröhlich. Das zweite ist
in Moll geschrieben, die Tonfolgen treffen ins Herz, stimmen melancholisch. Unser russischer Begleiter Artjom fängt plötzlich an zu weinen. Erst später weiß ich warum: Die Kinder singen, „Soldaten beschützt uns!“. Der gelernte Tischler ist selbst Vater. Die Liedtexte wirken tief in ihm, machen ihn vermutlich ein Stück hilflos. Gern hätte auch er sie davor bewahrt, Mutter und Vater zu verlieren.
Ich habe dort Gelegenheit in die Augen der Kinder zu schauen. Es ist im Grunde nichts
Außergewöhnliches zu entdecken. Sie verhalten sich wie unsere Kinder. Offenbar schaffen
diese Erzieherinnen und Lehrerinnen es, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich die Kinder aufgehoben fühlen. Sie haben nur noch sie. In das Herz kann man freilich nicht schauen, ihre Mütter und Väter sind tot, werden keinen Geburtstag mit ihnen feiern, eine gelungene Theatervorstellung bejubeln oder ihre Tränen trocknen, wenn sie einmal traurig
sind. Das schnürt mir wirklich die Kehle zu. Dieses Gefühl begleitet uns auf jeder unserer
Stationen. Wir sehen ältere Damen, die in einem Ort übrig geblieben sind. Der Bus, in
dem ihre Männer saßen, wurde auf dem Weg zur Arbeit bombardiert. Die Lehrerinnen in
Gorlovka wünschen sich für ihre Schüler einfach nur Kindheit, denn sie spielen nicht mehr.
Das sagt mir die Lehrerin unter Tränen. Später sehen wir auch die restlichen Überbleibsel
an Ziegelsteinen des Hauses eines älteren Mannes. Er sagt: „Sechzig Jahre meines Lebens
sind zerstört“ und zeigt uns die Mörsergranaten, die überall herumliegen im halb
zertrümmerten Haus. Mit Eisenstangen sicherte er heute Morgen wenigstens den Dachstuhl.
Stepan, so ist der Name des Mannes, schläft nun im Keller. Er und seine Frau könnten
auch bei einigen Nachbarn unterkommen, erfahren wir, aber er winkt ab, „ich habe
noch meinen Garten!“, sagt er. Der ist ihm geblieben und irgendwie werden sie es schon
schaffen.
Krieg hat ein bizarres Gesicht. Die Empfindung ist für Friedensstaatler wie uns irgendwie
surreal, scheint unwirklich und nicht greifbar zu sein. Das Gefühl kennt die Nachkriegsgeneration in dieser Form nicht, und uns ist nicht annähernd bewusst was es bedeutet, mit einer anhaltend quälenden Angst vor einem neuen Granatenangriff zu leben, mit den klaffenden Löchern in den Straßen, den durchschossenen Wänden zerbrochenen Fensterscheiben in der Wohnung und mit verminten Wäldern. Wir sahen zwar nie die abgetrennten Gliedmaßen und die um Luft ringenden Menschen, die blutüberströmt und vor Schmerzen schreiend oder gar tot auf dem Gehweg lagen, aber wir sehen es in jeder
Straße. Wir gehen an unzähligen Gräbern und Gedenktafeln vorbei, die dort täglich mit
Blumen bedacht werden. Und wir trafen Menschen, die den Tod sahen. Ich konnte es in
ihren Augen sehen, die eine Melange von bitterster Trauer und mutiger Entschlossenheit
ausstrahlen, sich nicht mürbe machen zu lassen – bei all dem Horror.
Treffen mit Sachartschenko
Alexander Sachartschenko treffen wir, es war eher ein Zufall. Er ist der Präsident der Volksrepublik, 42 Jahre alt, Sohn eines Bergmannes, Ingenieur, verheiratet, er hat drei Söhne.
Sachartschenko nahm 2014 in Donezk an den Kämpfen teil, wurde mehrere Male verletzt.
Danach führt er das Land mit 2,4 Millionen Einwohnern. Sein Haar ist ergraut nach vier
Jahren Krieg. Ich kannte ihn bis dahin nur aus den Pressekonferenzen im russischen Fernsehen.
Auch Sachartschenko hat dieses Leid gesehen, unzählige tote Frauen und Kinder.
Makaber ist die Schilderung zu einem Mord der ukrainischen Soldaten an einer schwangeren Frau. Er erzählt mir, ihr Bauch war aufgeschlitzt und ihr Körper wurde mit Bauschaum überzogen. Andere Einwohner wurden vom ukrainischen Militär in große Löcher geworfen und einfach verscharrt, fügt er in bitterem Ton hinzu. Ich würde gerne weghören.
Es ist furchtbar, was ich höre, aber diese Details müssen erzählt werden, gehören sie
doch zur unsäglichen Tragik dieser ekelhaften Ereignisse dieser Sadisten. Darf ich so etwas
später erzählen, frage ich mich. Ja, ich muss. Der Krieg hat auch Arme und Beine,
hübsche Gesichter, ein Herz. Es sind Menschen, die nichts mit Krieg im Sinn haben. Die
Donezker Einwohner haben die Opfer alle freigelegt und in ihren Heimatorten begraben.
Es sind über 13.000 dieser traurigen Orte.
Leben unter Beschuss
Für uns ist es eine unverständliche Parallelwelt in Anbetracht der schlimmen Situation. Der Geist flüchtet sich in eine Art Kokon hinein, weil man sich vor dem Leid zu schützen versucht. Es ist doch sehr bitter, zu behaupten, ausschließlich durch Betrachtung vor Ort, durch das Berühren der verschossenen Munition und den Blick auf die tausenden Gräber mit den Geburtsdaten, sich der Gefahr, der Gräueltaten und des Terrors bewusst zu sein. Aber wir spüren die Anspannung, an keinem Tag spürst du Entspannung. An keinem. Du liegst im Bett in deinem Hotel und siehst von
weitem Granateinschläge, Blitze, Feuer und Qualm. Es dröhnt und ich frage mich
manchmal, ob die nächste Granate möglicherweise das Hotel trifft oder irgendeinen anderen Platz, auf dem wir uns am Tag bewegen. Nur ein paar Kilometer von der Demarkationslinie entfernt, befinden wir uns im Stadtzentrum von Donezk. Hier ist quirliges Leben. Elegante Frauen in schönen Sommerkleidern und Absatzschuhen spazieren da, Schüler sitzen auf einer Bank und lesen ein Buch, ein Wasserspiel plätschert um eine eiserne Kugel, ein Hochzeitspaar beobachte ich. Es trifft sich unter den Bäumen im Park, um Fotos zu machen und trinkt Sekt. Sie haben sichtlich Spaß, lachen ausgelassen und wir freuen uns mit ihnen.
Wir besuchen die Kinder vor Ort in einigen Waisenhäusern. Begleitet werden wir von
Wladimir Fedorowitsch. Er ist Präsident des SDM-Hilfsfonds (www.sdm-fond.ru), der aus
dem 200 Kilometer entfernten Russland regelmäßig für über 500 Kinder, Behinderte und
etwa eintausend psychisch Erkrankte, Hilfskonvois in das Krisengebiet schickt. Er fuhr uns
persönlich mit einem Bus von Rostow am Don ins Grenzgebiet um Donezk und begleitete
uns bei allen Stationen dieser Mission. Was fanden wir vor? Es war kein Film auf irgendeiner
Kinoleinwand oder ein „Ballerspiel“, zu dem Jungs Chips essen. Es gab keinen Moment,
indem du über einen Friseurtermin oder die Kneipe nachdenkst. Dort drüben, auf
der anderen Seite der Menschheitsfamilie, wird scharf geschossen. Ich weiß heute, wie
sich Granaten anhören, ich habe sie gesehen, aus welcher Richtung sie kamen und aus
welcher Entfernung geschossen wurde. Die Bürgerwehr in Donezk schoss nicht zurück. Sie
hatten strengen Befehl nicht zu schießen. Das hörten wir an verschiedenen Stellen, bei
denen wir nachfragten. Sie dürfen nicht zurückschießen, um eine Eskalation zu vermeiden.
Am Nachmittag waren wir eingeladen zu Kaffee und Kuchen. Die zwitschernde Frühlingsidylle wurde durch Mörsergranaten gestört. Ich lauschte im Schulraum, bis der Beschuss in der Nähe vorbei war. Ich war schockiert und zuckte zusammen, konnte vom selbst gebackenen Kuchen nicht mehr essen, den mir die Kinder gebracht hatten. Die Kinder blieben still und ruhig. Ich erfuhr, sie haben sich an diese Situation bereits gewöhnt. Unglaublich, nicht? Nach solch einem Beschuss macht man in Donezk im Takt seines Miteinanders weiter, klebt die Fenster mit Papier ab, nagelt sie mit Brettern zu. „Eine Reparatur lohnt erst, wenn keine Granate mehr fliegt“, das erzählt ein älterer Herr von der örtlichen Miliz und lächelt. Das fühlt sich alles sehr skurril an. Die nackte Realität gibt ihm recht. Manchmal werden sarkastisch Scherze darüber gemacht, dass die Frauen schon wissen, mit welcher Munition geschossen wird. Ihre Sinne sind nunmehr über vier Jahre geschärft, ausgerichtet auf dieses Pfeifen und Zischen, auf Lichtblitze und Erschütterung, dumpf schallende Töne, die vom Einschlag der Granaten rühren. Wir nehmen uns die Zeit für die Ruhe, sind einfach nur müde und versuchen, für einige Stunden die Gefahr zu vergessen, weil wir sonst verrückt werden, vor Sorge und, weil wir sonst unserem Körper schaden würden.
Die Gesamtsituation hat nichts mehr mit weniger oder mehr Hab und Gut zu tun. Auf alles
würdest du verzichten, wenn du kräftezehrende Anspannung spürst, den anhaltenden
Druck und oft die nackte Angst, dass jeden Moment eine Granate einschlägt. Du möchtest
es einfach nicht mehr spüren. Ruhe soll sein. Einfach nur Ruhe.
Das hören wir auch von den Kindern in der Schule, die unlängst in ihrem Schulbus beschossen wurden. Am Nachmittag im Waisenhaus bangt man um eine wichtige Wasserzisterne in der Nähe. Die droht, zerstört zu werden. „Die halbe Stadt wird damit versorgt,“ erzählt uns die ältere Dame am Tisch. Auch sie trägt die grünliche Uniform der Miliz, wie ihr Ehemann. Sie ist dezent geschminkt und hat ein freundliches Gesicht. Wir lauschen ein wenig, bis irgendwann ein dumpfer Ton die gesellige Atmosphäre stört. Die Stromleitung funktioniert noch, vielleicht wurde eine Mauer getroffen. In den kleinen Orten um Gorlovka, die anderen Ortsnamen sind etwas kompliziert auszusprechen, bewahren die Menschen ihre gewohnten Rituale, säubern Straßen und Plätze direkt nach Angriffen. Es blühen rote und gelbe Tulpen in den Gärten, obwohl oftmals keiner mehr dort wohnt. Dachstühle sind schwarz, vollkommen ausgebrannt oder zusammengefallen. In einem Haus
kocht man in der noch vorhandenen Küche das Mittagessen, gibt Kindern Unterricht, die
Musiklehrerin spielt Klavier, der Bürgermeister sitzt an seinem Schreibtisch – über ihm
hängen an der Wand die Porträts von Alexander Sachartschenko und Wladimir Putin -,
üben die Kinder Lieder und Gedichte, putzen sich die Mädchen bei Besuchen mit hübschen
Kleidchen heraus und frisieren sie sich gegenseitig. Das nennen sie, Hygiene für
den Geist. Nur einen halben Kilometer weiter stadteinwärts wird nicht geschossen, weil
lediglich die Pufferrandgebiete von Artilleriebeschuss betroffen sind. Wir beobachteten
stinknormales Leben, geöffnete Supermärkte, Boutiquen, Blumenläden, gut besuchte Restaurants.
Das gepflegte Shakhtar Plaza Hotel, in dem wir untergebracht sind, ganz in der Nähe des
Lenin-Parks und dem überwältigenden Sport-Stadion, ist dieser Tage sehr günstig. Es ist
exklusiv ausgestattet und befindet sich nur 1,5 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Der
Massagesalon und die Hochzeitssuite werden trotzdem genutzt, der Barbetrieb funktioniert
und die Küche zaubert ein leckeres Essen. Trotzdem, die Menschen brauchen Hilfe
durch Friedensbemühungen. Sie sind müde, die Kraft schwindet und es ist genug Blut geflossen.
Viele Menschen bleiben trotz der massiven Demütigungen in ihren Orten wohnen,
die Geisterorte geworden sind. Die Regierung der Donezker Region hat sie um Umzug
gebeten, aber die Menschen möchten dem Terror trotzen. „Es ist unser Grund und
Boden, unser Haus. Wir werden es nicht verlassen,“ sagen sie. Manche sind auch zu alt,
um irgendwo neu zu beginnen, einige zu arm.
„Die finanziellen Hilfen der EU sind in den Volksrepubliken nicht angekommen“, hören wir
vom Berater des Präsidenten, Alexander Kasakow, mit dem wir uns etwa zweieinhalb
Stunden in der Hotellobby unterhalten. „Das Geld ist nach Kiew überwiesen, von dort
aber nicht weitergereicht worden.“ Pedro Poroschenko lässt die Region am langen Arm
verelenden, deshalb half Russland mit Zuwendungen aus. Das hat sich unter Präsident
Wolodomir Selensky, dem freundlich lächelnden Fernsehstar, nicht geändert. Das Kalkül
Kiews ist Erpressung. Aber acht Jahre aushalten unter diesen widrigen Bedingungen, sind
wohl Beweis genug, dass dieses stolze Volk sich nicht in die Knie zwingen lässt. Kasakow
erzählt uns, dass sie Sanktionen ausgesetzt sind und dringend Hilfe benötigen. Wir hören,
es gibt aus dem Ausland, etwa aus Italien, sehr gute Kontakte und man bemüht sich in
der Region auch eigene Produkte zu schaffen. Uns wurde klar, was es bedeutete, Sanktionen hinnehmen zu müssen, und unser Respekt war groß, dass mit dem, was vorhanden war, gut umgegangen wurde.
Treffen mit Sachartschenko
Was uns besonders beeindruckte, war eine Einladung des Präsidenten Sachartschenko.
Wir aßen mit ihm, sprachen mit ihm über unsere Eindrücke, über Sichtweisen, und er
scherzte. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, die er uns erzählte. Wir sollten ein
selbstgebrautes Bier, ein – wie er sagte – altes Rezept probieren. Er erzählte uns, diese
Brauerei hatte einst Stalin bauen lassen für die Bergarbeiter. Denn sie hatten sich die gewünscht.
Das Bier schmeckte lecker und wir aßen an einer langen gedeckten Tafel Schinken
und Früchte. Etwas bizarr, so empfanden wir, inmitten von seinen Beratern und Soldaten
zu sitzen, die ihn mit Maschinengewehren bewachten. Bei einer Begebenheit schien
der Präsident allerdings etwas die Verhältnismäßigkeit verloren zu haben. Ich hatte, bevor
wir zu diesem Termin gefahren waren, Blumen in einem Geschäft gekauft. Von zu Hause
mitgebracht hatte ich noch einen Bildband aus dem Rheinland, mit den Burgen und
Schlössern, in russischer und französischer Sprache, und wollte es eigentlich an unseren
Begleiter Artjom verschenken. Aber ich dachte mir, beim Präsidenten wäre es genauso
gut aufgehoben und für Artjom könnte ich später noch ein anderes Exemplar besorgen.
Dass ich Sachartschenko Blumen schenkte, muss bei ihm ungewöhnlich angekommen
sein, wie ich später erfuhr. Während wir so plauderten und uns miteinander bekannt
machten, Geschichten erzählten und Geschenke tauschten, kamen zwei Soldaten in den
Raum. Der eine hatte einen großen cremefarbenen und der andere einen tiefroten Strauß
Baccara-Rosen im Arm. „Baccaras“, staunte ich und machte mir sonst keine weiteren Gedanken.
Ich hatte das gerade wahrgenommen, da steht Sachartchenko in diesem Moment
auf und geht zu den Soldaten. Er nimmt zuerst die roten Baccara-Rosen und schenkt
diesen Strauß Biggy, einer Frau aus unserer Gruppe, die sich schon viele Jahre mit dem
Konflikt im Donbass beschäftigte. Und dann kam er zu mir und übergab mir den cremefarbenen Strauß. Ein großes langes Bündel, so dass ich beide Arme ausstrecken musste, um diesen Strauß überhaupt zu umfassen. Viel zu schwer für mich, ihn später zu tragen und überhaupt, wir wollten ja in zwei Tagen wieder abreisen. Was macht man mit so vielen wunderschönen Rosen und: ist es verhältnismäßig? Das fragte ich mich, verwundert
und geschmeichelt. Ich nahm an, dass ich seine männliche Ehre ein wenig gekitzelt hatte.
Vermutlich deshalb musste es ein übergroßer Strauß sein, damit ich das verstand.
Ich überlegte, vielleicht könnte ich die Rosen an einem passenden Platz ablegen. An dem
Ort, den wir am Vortag besucht hatten. Auch da hatten wir Blumen niedergelegt.
Kinderdenkmal
Die „Allee der Engel“ ist eine Gedenkstätte. Dort besuchten wir Kinder, deren Namen und Alter in eine Tafel graviert sind. Wir lesen uns durch Namen und Alter der Kinder. Sie waren 1, 5 oder 16 Jahre jung. Für mich als Mutter ist das ein furchtbar beklemmendes Gefühl. Es
machte mich tief traurig. Einige Zeit verharrte ich schweigend an der eisernen Tafel mit
den unzähligen Namen. Mir erscheinen die Bilder, die ich aus den Videos kenne. Bilder
blutverschmierter, von Granatsplittern zerrissene Gesichter sind es, an vielen Körpern fehlen
Gliedmaßen. Niemand soll das verschrecken, daher hält man sie im Netz zurück. Wie
kann man nur Kindern dieses Schicksal angedeihen lassen? Sie sind doch gerade geboren
worden, von frohem, unbeschwerten Gemüt und ihre Seelen sind rein, und sie wollten die
Welt doch erst entdecken! Nun liegen die kleinen Körper im Donbass begraben. Über die
Gedenktafel rankt ein Meer aus Blumen. Metallene Rosen sind es, die im zarten Licht des
Tages kupfern glänzen, ein Teil der Pflanze ist in tiefes Schwarz getaucht. Ich schaue genauer hin und erkenne, es sind Granathülsen, deren Schaft hälftig eine Vase versinnbildlicht und aus der kerzengrade ein langer fester Stiel ohne Dornen herausragt. Daran haften gefiederte Blätter, mindestens drei an jedem Stiel, die nach ihrem natürlichen Vorbild bearbeitet wurden, obenauf sitzt jeweils eine gefüllte Blüte. „Es ist Munition, die hier im Donbass gefunden worden ist“, erklärt mir Victor Mikhalev. Der Kunst- und Metallschmied Mikhalev hat in Tausenden von Stunden die Instrumentarien des Bösen in die Symbolik des Paradieses und der Liebe verwandelt. Seine Werkstatt befindet sich ganz in der Nähe.
Es ist eine aufwendige Handarbeit und ich freue mich über ein Exemplar, das er mir
schenkt. Die Rose begleitet mich jeden Tag zu Hause und erinnert mich an diesen Besuch.
Mikhalev ist Mitglied der Akademie der Künste. Er hat für seine Installationen viele Preise
bekommen. Seine Kunstwerke zieren in Donezk die meisten Gräber. Die gesamte Region
ist gespickt mit Kriegsgräbern, wo man nur hinschaut.
Wie die Landkarte, in der der Bürgermeister von Gorlowka die Angriffe auf sein Dorf dokumentiert.
Abreise Hals über Kopf
Und beinahe hätte mein Mann wohl eine Detonation selbst ausgelöst. An einer
völlig zerbombten Bushaltestelle stiegen wir aus dem alten rostigen Bus aus. Rostig,
damit wir nicht auffallen in der „Grauzone“, denn neue Busse waren oft Ziel der Scharfschützen, die sich, wie wir erfuhren, hinter den Häusern versteckten. Und plötzlich rief unser Sicherheitsmann Anton ungewohnt und bitterernst, „Vorsicht, bleibt stehen!“ Zwanzig Zentimeter neben dem Fuß meines Mannes hatte sich eine Mörsergranate in den Boden gebohrt, vermutlich ein Blindgänger. Wir begriffen die Gefährlichkeit, durch solch ein Gebiet zu gehen. Einen fünfjährigen Jungen hatte es das Leben gekostet. Trotz der vielen Warntafeln in der Schule, griff er auf der Straße, er wollte spielen, nach einer solchen
Granate und es zerfetzte seinen Leib.
Nachdem wir bei Präsident Sachartschenko noch einen Meerrettich-Schnaps getrunken
hatten, der wirklich sehr sehr eigenartig schmeckte, was mir Sachartschenko deutlich im
Gesicht ablas (er lächelte dabei), weil ich schreckliche Grimassen zog, bemerkte ich, dass
die Berater von Sachartschenko plötzlich nervös an ihn herantraten, sie sprachen leise.
Wenige Momente später erfuhren wir, dass wir umgehend die Stadt verlassen müssten,
denn die Westukraine, so seine Informationen, würde einen Frontalangriff planen. Wir waren überrascht und wurden von Artjom gebeten, Ruhe zu bewahren, ins Hotel zu fahren
und in fünfzehn Minuten unsere Taschen zu packen. Im Bus hörten wir den russischen
Chanson „Wladimirskij Zentral“ von Michail Krug etwas leiser als sonst und beobachteten
die Umgebung. Wir hofften, dass wir noch rechtzeitig die Grenze erreichen würden.
Ich machte mir Gedanken während der Fahrt zur gesellschaftlichen Situation. Mehr als 70
Prozent der Bevölkerung in Donezk und Lugansk ist russischstämmig. 187 verschiedene
Nationalitäten lebten in der Ukraine vorwiegend friedlich miteinander, mit unterschiedlichen Bräuchen und Traditionen. Der ukrainische Präsident Poroschenko wollte den Russen die russische Sprache verbieten und es sollte nur noch Ukrainisch gesprochen werden.
Das brachte letztlich das Fass zum Überlaufen, nach dem Putsch am Maidan und dem
Massaker im Gewerkschaftshaus in Odessa. Damit begann der heiße Krieg im Donbass,
es folgte eine Schlichtung über Minsk 1 und 2, Waffenstillstand wurde verordnet. Doch
die West-Ukraine hielt sich nicht daran, provozierte. Sie wollte über die Donbassrepubliken
die Konfrontation mit Russland erzwingen und deshalb nannte sie ihren kriegerischen
Plan „Anti-Terror-Operation!, der ein einseitiger Terror von westukrainischer Seite ist. Dieser
endete am 30. April 2018 und wird nun auf eine neue aggressivere Stufe gestellt, die sich die „Operation der Vereinten Kräfte“ nennt. Das bedeutet nichts anderes als eine militärische Frontaloffensive, um die Regionen Donezk und Lugansk zurückzuerobern, was
die Bevölkerung in den Donbass- Regionen gar nicht will. Alexander Sachartschenko
meinte eben noch, „wir streben lediglich Frieden an und den gilt es zu gewinnen, um unsere Städte so bauen zu können, wie es sich unsere Bürger vorstellen.“ Der letzte Satz,
den ich von ihm höre, bevor wir uns verabschieden, ist, „es wird der letzte Krieg in der
Ukraine sein, wir sind vorbereitet.“
Es gibt viele Gründe, und wir hörten es in Donezk immer wieder, sich gegen die westliche
Politik zu entscheiden. Donezk und Lugansk spalteten sich ab, es ist ihr Recht auf Selbstbestimmung, so empfindet es die Bevölkerung. Die internationale Gemeinschaft sollte ihnen diese Freiheit zugestehen.
Alexander Sachartschenko lebt gerade noch vier Monate.
Durch einen Sprengstoffanschlag in der Stadt Donezk, vermutlich von Mitarbeitern des
ukrainischen Geheimdienstes, werden er und einer seiner Berater umgebracht. Der
Sprengstoff befand sich in der Deckenleuchte des Clubs Separ, den er regelmäßig besuchte, um sich mit seinen Kameraden abzustimmen. Eine Überwachungskamera filmt
noch den Eintritt Sachartschenko in den Club und den Beginn einer heftigen Detonation.
Ich sehe die Bilder nach dem Sprengstoffattentat vom 31. August 2018 ….Entsetzlich.
Als wir an der Grenze ankommen, ist sie schon geschlossen. Unser Begleiter Artjom hat
die Mobiltelefonnummer von Sachartschenko. Ihn ruft er an. Währenddessen er telefoniert,
beobachten wir am Knotenpunkt viele junge Männer, die mit Rucksäcken gekommen
sind. Später erfahre ich von Artjom, das sind junge Männer, Russen, die aus der ganzen
Welt nach Donezk gekommen sind. Sie wollen sich hier ausbilden lassen oder haben
sich vom russischen Militär beurlauben lassen. Sie sind gekommen, um eine Waffe in die
Hand zu nehmen, und sie führt etwas nach Donezk, was für eine Reihe von Menschen in
der westlichen Welt schlichtweg nicht begreifbar oder nachvollziehbar ist. Für mich als
Ostdeutsche schon. Sie haben einen Bezug zu den Menschen, fühlen sich verbunden, haben selbst Verwandte oder Freunde von Bekannten im Donbass verloren, die seit Jahren
beschossen werden. Es bedeutet für Russischstämmige Patriotismus in der Art, für ihre
Landsleute einzustehen, wenn sie sich in bedrohlichen Situationen befinden. Und auch
nur deshalb sind diese jungen Männer hier nach Donezk gekommen, um die Miliz zu unterstützen.
Nachdem Artjom alle Formalitäten mit dem Grenzposten geklärt und der Präsident
am Telefon mit dem Leiter der Dienststelle gesprochen hatte, können wir weiterfahren.
Über 200 Kilometer nach Rostov am Don. Dieses Mal fahren wir direkt zum Flughafen
und machen keinen Stopp.
Ich habe auf der Heimreise viel zu tragen. Dieses Mal gleich zwei Taschen. Mein Mann hat
sich entschieden, den riesigen Blumenstrauß für mich zu tragen. Durch die verfrühte Abreise konnte ich ihn nicht mehr zu den Kindergräbern bringen. Ins Flugzeug möchte ich
ihn nicht nehmen, er würde einfach zu viel Raum beanspruchen. Deshalb entscheiden wir
uns am Flughafen direkt am Eingang, da wo die Taschen kontrolliert werden, allen Frauen
die dort passieren, eine Rose zu schenken. Wir haben viel Zeit in der Nacht, müssen am
Flughafen einige Stunden auf den Flug warten und kommen sogar mit der einen oder
anderen Frau ins Gespräch. Sie freuen sich und die Männer haben so viel Spaß an der
Freude dieser Frauen, dass sie mir einige von den gefühlt hundert Blumen abnehmen.
Kräftige große Männer, gestandene Familienväter stehen da im Eingang des Flughafens
in Rostow am Don und beweisen sich als Rosenkavaliere. Wir genießen das alle.
Die Propaganda ist ein Problem im Westen, auch gut informierte Menschen merken es
kaum noch, wie vermutlich ich vor über dreißig Jahren, als ich als junge Frau aus der DDR
in den Westen kam und einige Gewohnheiten oder destruktiven Strukturen eines anderen
Gesellschaftskonzepts nur schwer erkannte. Heute weiß ich, wir tragen West, wie Ost,
eine Bürde, und das ist Erkennen. Es ist wichtig, sich damit zu befassen, Fehler anzuerkennen.
Zurück in Deutschland
Zurückgekommen in Deutschland schreibe ich meine Geschichte auf und versuche
beim öffentlich-rechtlichen Sender SWR Gehör zu finden. Niemand scheint die Fronten
genau zu kennen. Ja, dort schießen Ukrainer gegen Ukrainer, gegen ihre Landsleute.
Kein Redakteur erwähnt, dass dieser Beschuss die Minsker Verträge verletzt, dass die
Minsker Verträge sagen, dass niemand die Demarkationslinie übertreten darf. Die Minsker
Verträge sagen auch, dass nicht geschossen werden darf und, dass die „Rebellengebiete
im Osten einen Sonderstatus erhalten“ sollten. Ein entsprechendes Gesetz sollte das Parlament der Ukraine spätestens 30 Tage nach Unterzeichnung des Abkommens verabschieden, also bis zum 13. März 2015. Geschehen ist dies bis heute nicht. Die Regierung in Kiew weigerte sich den Sonderstatus für eine gewisse Autonomie im Osten des Landes zu erlauben, obwohl es im Abkommen festgelegt wurde. Und auch dieser Fakt hat sich bis heute nicht geändert. Obwohl Kiew behauptet, für die Einheit der Ukraine zu kämpfen, hält Kiew bis heute eine Hungerblockade gegen die „eigene“ Bevölkerung im Osten des Landes aufrecht. Es lohnt, den Text des Minsker Abkommens zu lesen. Russland wird darin nicht einmal erwähnt, soll aber das Abkommen umsetzen? Ich versuche das zu vermitteln und werde immer wieder nach Mainz, von Mainz nach Koblenz von Koblenz wieder nach Mainz und zurück verbunden, bis sich meine Wut und mein Unverständnis in
Tränen auflöste. Ich schluchzte am Telefon und eine Redakteurin hört mir endlich zu. Ich
empfehle ihr genau hinzuschauen, wer hier gegen wen kämpft und wen Deutschland dort
unterstützt, wie es den Menschen geht und wie viele Gräber ich gesehen hatte. Sie notiert,
so sagt sie, einige Argumente und verspricht mir, in der Redaktion das Thema anzusprechen.
Wir haben Januar 2022 und wieder hören wir im öffentlich-rechtlichen Radio eine Lüge,
nämlich, dass Russland eine „Invasion auf die Ukraine plant“. Russlands Armee steht in
Rostow am Don, viele Kilometer von Donezk entfernt. Und auch heute bemerke ich, viele
Menschen wissen nicht einmal, wo der Donbass liegt, viele Menschen wissen gar nicht,
welche Republiken sich aus welchem Grund abspalteten und von wo die Gefahr lauert.
Russland ist nicht die Gefahr. Wem nutzt das im Donbass? Wem nutzt das auf der anderen
Seite der Ukraine? Und wann begann wirklich die Krise, die im Donbass zum Krieg führte?
Westlich eingenordete Politiker prusten in jedes nur verfügbare mediale Rohr, bösartig
und blind. Auch die Unterstellung, dass Präsident Putin ein neues Sowjetreich schaffen
wolle, ist sachlich falsch. Denn tatsächlich sagte er, „dass der Zerfall der Sowjetunion eine
der größten Katastrophen des 20. Jahrhunderts war.“ Er begründete die Aussage, dass
dieser Zerfall die Kriege und instabilen Verhältnisse in vielen Teilen der Welt heute maßgeblich begünstigt oder gar mitverursacht hat. Den angeblichen Wunsch von einem neuen Sowjetimperium muss der Ex-Profiboxer Vitali Klitschko, heute Bürgermeister in Kiew, offensichtlich in den deutschen Medien aufgeschnappt haben, obwohl er das original Zitat Putins doch auf Russisch verstehen müsste, er hat diese Sprache in der Schule gelernt.
Das Betteln für Waffen in Deutschland steht ihm nicht. Wie ich von Freunden aus der
Ukraine hörte, lachen selbst die Kiewer über ihn, weil er die neue Sprache Ukrainisch nicht
richtig aussprechen kann. Das ist übrigens auch bei Poroschenko so, der Ukrainisch als
Amtssprache einführte und damit alle Russischstämmigen vor den Kopf stiess. Ukrainisch
wurde bis dahin meist nur auf dem Land gesprochen, oft auch nur ein Art Kauderwelsch,
da in der Ukraine sehr viele Ethnien zusammenleben. In den Städten schrieben und sprachen die Menschen jedoch Russisch.
Minsk Zwei ist offenbar die zu Papier gebrachte militärische Niederlage eines US-Marionettenregimes in Kiew, die der Westen nicht anerkennen will. Das kriegerische Zündeln der Westmächte gehört in den größeren Allmachts-Expansionsplan der NATO, nachdem US-Außenminister James Baker Michail Gorbatschow 1990 in die Hand versprach, das „auf den Pelzrücken“ zu unterlassen, rückte die NATO auf den Pelz. Russland hat Anspruch auf Integrität und Schutzraum. Die USA braucht den militärischen Konflikt der
Ukraine im Donbass, damit es einen Vorwand gibt, um gegen Russland weitere Sanktionen
verhängen zu können und ihre Waffengeschäfte zu machen. Alle bisherigen Sanktionen
gegen Russland sind verpufft und sie schützen nunmehr ihre eigenen Grenzen. Gibt
es gesichtswahrende diplomatische Lösungen? Vielleicht behält Alexander Sachartschenko
damit recht, dass es „der letzte Krieg in der Ukraine sein wird“. Es ist einzig die Entscheidung der NATO, ob und wann endlich Frieden einkehrt.
Nachtrag
Ich schreibe die letzten Zeilen meines Beitrages und höre, dass heute in Berlin
die Kontaktgruppe des Minsker Friedensabkommens im sogenannten „Normandie-Format“
neun Stunden lang mit der Ukraine, Russland, Frankreich und Deutschland verhandelt
hat. „Kein Ergebnis, keine Einigung zu nichts“, vermeldet der Unterhändler Russlands
Dmitri Kozak, Vize-Ministerpräsident der Regierung Russlands, der dazu meint, dass die
Ukraine gar keine Kompromiss-Lösung eingehen will und sich weigert „zentrale Punkte“
des Minsker Friedensabkommens anzuerkennen, geschweige denn zu erfüllen. Laut Kozak
habe Russland alles und bis zuletzt versucht, einen Kompromiss zu erzielen – aber die
Ukraine wollte und will keinen. Ich erinnere mich an ein Interview mit einem Scharfschützen
aus dem Kiew-seitigen Lager, das ich 2021 in einem Magazin las. Serhiy Varakin, sein
Kurzname ist „Smile!, gab in den Block des Reporters seine Absichten bekannt: „Ich
brauche keinen Frieden, ich brauche Sieg…Meine Aufgabe ist es, Feinde zu eliminieren,
so viele wie möglich.“
Der Journalist Dirk Pohlmann hat in wenigen Worten skizziert, wie Deutschland in Sachen
Ukraine, Russland, Nordstream 2 usw. an der Nase herumgeführt werden und was uns
droht. „Nordstream 2 gibt es, weil die deutsche Regierung es wollte, nicht weil die russische
es wollte. Deutschland braucht Gaslieferungen, um sicher Grundlast-Strom produzieren
zu können, nachdem die Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Die USA versuchen die
Pipeline zu stoppen, seit vielen Jahren, mit vielen Mitteln und aus vielen Gründen: aus
geopolitischen, aber auch aus simplen wirtschaftlichen Interessen.“ Frackinggaslieferungen
aus den USA wären beides, ein Geschäft und erpressungsfähiger Einfluss auf
Deutschland. Es gibt einen Interessenkonflikt zwischen den USA und seinem nicht-souveränen Vasallen Deutschland. Die NATO existiert, um die Amerikaner drinnen, die Russen draußen und die Deutschen unten zu halten, sagte ihr erster Generalsekretär Lord Ismay bereits in den 50er Jahren. Und das gilt immer noch.